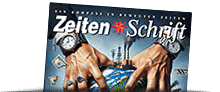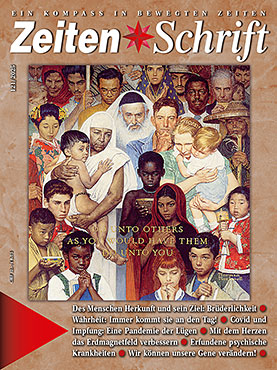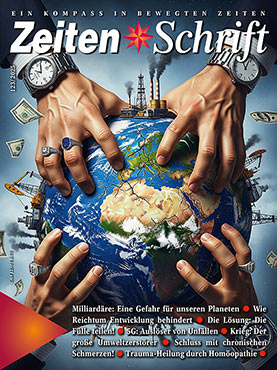Psychiatriewahn: Niemand braucht eure Diagnosen!
Sämtliche psychiatrischen Erkrankungen werden von nur ungefähr 150 Experten definiert; erstaunlich viele erhalten Geld von der Pharmaindustrie. Inzwischen gilt fast jede menschliche Regung als pathologisch. Es wird Zeit, dass wir uns nicht von Experten sagen lassen, was normal ist und was nicht. „Wahnsinn“ war schon immer ein Konstrukt.

Isoliert und stigmatisiert: Allzu häufig bekommen Kinder heute eine psychiatrische Diagnose, um sie ruhigzustellen.
Es ist niemandem zu wünschen, von der geliebten Person nicht erhört zu werden. Wie qualvoll das sein kann, schildert Johann Wolfgang von Goethe in seinem 1774 veröffentlichten Roman Die Leiden des jungen Werther. Ohne Lotte gäbe es dieses Leiden nicht. Sie ist die Frau, an die der liebestrunkene Protagonist all sein Sehnen heftet. Er fühlt sich ganz und gar angezogen von ihren „lebendigen Lippen“ und „frischen, munteren Wangen“ und dem „herrlichen Sinn ihrer Rede“. Seine nicht endend wollende Schwärmerei kippt fast schon, wie es eben bei Verliebten so ist, ins Närrische. Doch jedes Hoffen, erhört zu werden, ist vergebens. Lotte ist einem anderen versprochen, sie vermählt sich alsbald mit ihm und Werther, der sich seinem Seelenschmerz immer mehr überlässt, schreibt ihr schließlich tief betrübt: „Ich will sterben.“ Und tatsächlich, er findet nicht mehr heraus, er taumelt dem Tod regelrecht entgegen – und in einer Mitternachtsstunde schießt er sich schließlich mit einer Pistole in den Kopf.
Dass Liebesgeschichten derart enden, ist freilich fern jeder Hollywood-Ideologie, mit der alle zeitgemäßen Romantiker auf das garantiert rosarote Happy End eingeschworen werden. Natürlich weiß jeder, dass der via Streamingdienst verbreitete Kitsch-Klimbim alles andere als alltagstauglich ist. Dennoch sind Abweichungen vom Schmonzetten-Ideal unbedingt unerwünscht. Oder anders gesagt: Sobald sich irgendein Rumpeln oder gar Scheitern in Liebesdingen anbahnt, wird alles versucht, es als etwas zu etikettieren, was nicht normal ist, also dringend behandlungsbedürftig. Dabei wird jede Selbstbeteiligung ausgeschlossen; behandlungsbedürftig ist also immer nur der andere. Das bedeutet auch, der traditionelle Liebeskummer, wie ihn der unglückselige Werther noch kannte, hat ausgedient.
Ghosting ist beispielsweise so ein Begriff, mit dem diejenigen hantieren, die sich dem Zeitgeist gemäß amourös betätigen. Gemeint ist damit der unerwartete Abbruch eines Kontakts. Jemand taucht ab, ohne jede Vorwarnung, ohne jede Erklärung, verschwindet also gespenstergleich. Er reagiert weder auf Anrufe noch auf digitale Nachrichten; jeder Versuch, den Kontakt wieder aufzunehmen, läuft ins Leere. Indizien für diesen Rückzug sucht man meist vergeblich. Die vorangegangenen Verabredungen ließen vielmehr das Gegenteil vermuten, oft bestand bereits eine Beziehung oder bahnte sich mindestens an.
Verschwenderischer Umgang mit psychiatrischen Diagnosen
Letztlich lässt sich Ghosting also auf einen Satz reduzieren: X meldet sich nicht mehr. Keine Frage, schön ist das nicht, aber muss man diesen charakterschwachen Fauxpas gleich zu einem Anglizismus aufblähen und damit mehr oder weniger subtil suggerieren, derjenige hätte nicht alle Tassen im Schrank? Denn tatsächlich und wohl nicht zufällig haftet dem Begriff Ghosting etwas an, das auf Tuchfühlung mit pathologischen Befunden geht. Im postmodernen Herzschmerz-Kosmos ist das übrigens längst gang und gäbe. Wer sich in Partnerschaften nicht gemäß den Erwartungen des anderen verhält, muss damit rechnen, als plemplem diffamiert zu werden. Die entsprechenden Begriffe schießen wie Pilze aus dem Boden. So wird ganz selbstverständlich von Worten wie Benching, Haunting, Mooning, Stashing oder auch Breadcrumbing gesprochen.
Nein, man muss diese Begriffe nicht kennen. Vielmehr sollte man sich fragen, was damit bezweckt werden soll. Wenn jemand sich nach einem Date nicht mehr meldet, meldet er sich eben nicht mehr. So etwas kommt vor. Das muss man nicht größer machen, als es ist.
Der Zeitgeist aber würde hier sofort widersprechen: Doch, muss man. Ihm gemäß gibt es offensichtlich gar kein Halten mehr: Hinter so ziemlich jeder menschlichen und zwischenmenschlichen Regung wird inzwischen ein behandelbares Syndrom gewittert. Beständig wird auf der Lauer gelegen, um mit einer vermuteten Diagnose zuschlagen zu können. Diese gesellschaftliche Lust am Pathologisieren könnte man fast schon selbst für pathologisch halten. Fest steht, dass mit psychiatrischen Diagnosen auffallend verschwenderisch umgegangen wird. Man denke nur an die Borderline-Persönlichkeitsstörung, die für die Betroffenen extrem leidvoll ist, aber in gewissen Kreisen sogar als schick gilt, nach dem Motto „Sind wir nicht alle ein bisschen Borderline?“. Auch das Asperger-Syndrom und andere Autismus-Spektrum-Störungen haben inzwischen den Status eines It-Pieces oder Statussymbols. Zu dem befremdlichen Phänomen, sich mit einer psychiatrischen Diagnose, die man gar nicht hat, schmücken zu wollen, gesellt sich der Trend, jedes Verhalten umgehend zu pathologisieren, das als unangenehm oder nicht konform empfunden wird. Unter Frauen ist besonders beliebt, über Männer zu behaupten, sie seien „narzisstisch gestört“. In den sozialen Netzwerken tummeln sich Hunderte von Influencerinnen, die dieses Thema beackern. Dabei sind die Pseudo-Psychologinnen hinsichtlich des Schweregrads ausgesprochen flexibel. So kann es einem Mann passieren, dass er bereits als „Narzisst“ abgestempelt wird, weil er den Hochzeitstag vergessen hat. Wahlweise spricht man auch von einem „toxischen Partner“. Gibt man das Stichwort bei YouTube ein, werden zig Videos angezeigt, die betitelt sind mit beispielsweise „25 Zeichen, dass du in einer toxischen Beziehung bist“ und „4 Tipps zum Umgang mit negativen & toxischen Menschen“. Allein: Woher kommen plötzlich all diese angeblich toxischen Menschen?
ADHS – eine konstruierte Krankheit
Auch Eltern sehen sich immer häufiger damit konfrontiert, dass ihr Kind von Erziehern und Lehrern als verhaltensauffällig und damit als therapiebedürftig eingeordnet wird. Was nicht bedeutet, dass es nicht immer mehr Kinder gibt, die Therapien bräuchten; gerade die rigorosen Pandemie-Jahre haben den Bedarf enorm gesteigert.
Doch grundsätzlich ist erst einmal ein gesundes Misstrauen geboten in einer Zeit, in der Diagnosen regelrecht boomen. Der US-Psychiater Allen Frances ist einer der größten Kritiker auf diesem Feld. Unter anderem legte er eine Streitschrift vor mit dem Titel „Normal. Gegen die Inflation psychiatrischer Diagnosen“ und weist immer wieder auf „neue falsche Epidemien“ hin. Dazu würden Autismus, bipolare Störungen und ADHS gehören. Seiner Überzeugung nach seien Kinder mitnichten „gestörter“ als früher. Der Harvard-Psychologe Jerome Kagan ging sogar so weit, ADHS eine Erfindung zu nennen. Dem schloss sich auch der Entdecker des Syndroms an, Leon Eisenberg, der sich später davon distanzierte und von einer „konstruierten Krankheit“ sprach.